Selbsthilfe & Merkmale
Selbsthilfegruppen zeichnet aus
- Die Mitglieder bzw. die Teilnehmenden sind alle vom gleichen Problem betroffen.
- Es gibt keine oder nur eine geringe Mitarbeit professioneller Helfer*innen.
- Es besteht keine Gewinnorientierung.
- Das gemeinsame Ziel soll eine Veränderung der Situation oder eine soziale Veränderung sein.
- Die Arbeitsform betont die gegenseitige Hilfe und die gleichberechtigte Zusammenarbeit.
Das A-E-I-O-U von Selbsthilfegruppen
A – Auffangen
Neue Gruppenteilnehmer*innen, die deprimiert, desorientiert sind und sich alleingelassen fühlen, werden in der Gruppe “aufgefangen”. Sie schildern den anderen ihr Leid und stellen ihre Situation dar. Die neuen Teilnehmer*innen sind nicht mehr alleine und die Angst wird durch die Offenheit in der Runde weniger.
E – Ermutigen
Teilnehmer*innen erhalten das Gefühl, es auch zu schaffen, mit der neuen Situation fertig zu werden.
I – Informieren
Teilnehmer*innen erhalten professionelle Informationen durch Vorträge von Fachleuten, Literaturhinweise …
O – Orientieren
Teilnehmer*innen von Selbsthilfegruppen können sich durch das Kennenlernen anderer, die an der gleichen Erkrankung leiden und durch den gegenseitigen Erfahrungsaustausch orientieren. Sie lernen, ihre eigene Situation zu relativieren, ihre Ansprüche und Erwartungen an sich, an ihre unmittelbaren Mitmenschen und an die Professionisten*innen im Gesundheitswesen neu auszurichten. So gewinnen sie an Lebensqualität zurück und können Strategien für ein erfolgreiches Bewältigungsverhalten aufbauen.
U – Unterhalten
Neben den “fachlichen” Kontakten, die sich auf die Erkrankung und ihre Bewältigung beziehen, sind auch gesellschaftliche, freundschaftliche Bindungen der Gruppenteilnehmer*innen untereinander durchaus erwünscht – wenngleich ein Selbsthilfegruppengespräch nicht mit einem “Kaffeehausklatsch” zu vergleichen ist.
Selbsthilfefreundliches Krankenhaus – Kooperation mit dem LKH Feldkirch
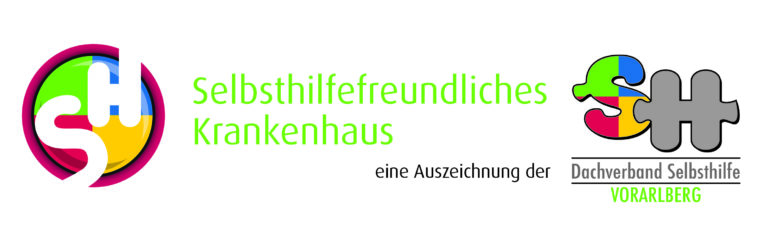
Wir freuen uns, dass das Landeskrankenhaus Feldkirch seit heuer Teil des Projekts „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ ist. Mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages setzen wir gemeinsam ein wichtiges Zeichen: Die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen und Selbsthilfe wird gestärkt und sichtbar gelebt.
Selbsthilfegruppen leisten einen wertvollen Beitrag für Betroffene und Angehörige. Durch den Austausch von Erfahrungen, gegenseitige Unterstützung und die Nähe zu Fachwissen wird ein Mehrwert geschaffen, der die medizinische und pflegerische Betreuung sinnvoll ergänzt.
Als Selbsthilfebeauftragter für das LKH Feldkirch steht Ihnen Mag. Harald Bertsch als zentrale Ansprechperson zur Verfügung. Er begleitet die Umsetzung des Projekts, fördert die Vernetzung und sorgt dafür, dass Selbsthilfe und Krankenhaus Hand in Hand arbeiten.
Gemeinsam möchten wir Betroffenen Wege aufzeigen, Türen öffnen und die Selbsthilfe noch stärker im Krankenhausalltag verankern.
Online Selbsthilfe Tools
Online-Gruppentreffen sind eine gute Möglichkeit für Menschen in ähnlichen Lebenssituationen, sich ortsunabhängig auszutauschen. Die virtuelle Selbsthilfe bietet dabei neue Wege, um auch ohne persönliche Treffen miteinander in Verbindung zu bleiben.
Selbsthilfekontaktstellen unterstützen diesen digitalen Austausch durch Beratung, Fortbildung und Arbeitshilfen für virtuelle Gruppentreffen. Damit diese gut funktionieren, braucht es klare Strukturen und Regeln.
Konferenzart wählen:
- Telefonkonferenz (nur Audio)
- Videokonferenz (mit Kamera)
- Kombination von Audio und Video
Mögliche Anbieter:
- Jitsi Meet: Kostenlos, einfach, datensparsam. Bei mehr als 5 TN kann es Probleme geben.
- Zoom: Kostenlos bis 40 Min. – Pro-Version DSGVO-konform.
- Eyeson: Browserbasiert, kostenpflichtig, wenig Funktionen.
- Skype: Weniger geeignet für Gruppen, kostenpflichtig.
- Teilnahme mit Passwort schützen.
- Nur vertraute Personen einladen (wie bei realen Treffen).
- Anonyme Teilnahme ermöglichen (Namensanzeige abstimmen).
- Abstimmung zu Beginn des Treffens über Datenschutz & Anzeige.
- Eine verantwortliche Person für das Treffen festlegen.
- Gruppenregeln (z. B. Gesprächsregeln, Anmeldung) vereinbaren.
- Themen im Voraus abstimmen.
- Datenschutzvereinbarung einholen (Formular bereitstellen).
- Blitzlichtrunde zu Beginn und Ende: Jede*r nennt Erwartungen & Stimmung.
- Gesprächsregeln aktiv ansprechen und ggf. moderieren.
- Gesprächsbedarf zu bestimmten Themen kann eingebracht werden.
- Probleme, Vorschläge und Anregungen dokumentieren.
- Für die nächste Planung berücksichtigen.
- Nur eine Person spricht gleichzeitig, in der Ich-Form.
- Kein Bewerten, keine Ratschläge – Feedback durch Erfahrung.
- „Warum“-Fragen vermeiden.
- Verschwiegenheit & Vertrauen sind oberstes Prinzip.
- Keine Screenshots oder Aufnahmen erlaubt.
- Mikro stumm schalten, wenn nicht gesprochen wird.
- Dritte dürfen den Bildschirm nicht sehen.
Patient*innenverfügung & ELGA
 Patient*innenverfügung
Patient*innenverfügung
Eine Patient*innenverfügung ist eine schriftliche Willenserklärung. Sie ermöglicht es Ihnen, im Voraus festzulegen, welche medizinischen Maßnahmen Sie ablehnen möchten – für den Fall fehlender Entscheidungsfähigkeit.
💻 Das ist ELGA
ELGA (Elektronische Gesundheitsakte) bietet Bürger*innen und Gesundheitsdienstanbieter*innen sicheren Zugriff auf Gesundheitsdaten – wie Laborbefunde, Entlassungsbriefe oder Medikamente.
- Höchste Datenschutzstandards
- Zugriff auf Befunde & Medikation
- Freie Teilnahme (Opt-out möglich)
📄 Patient*innenverfügung (PDF)
🌐 Mehr zu ELGA
☎️ ELGA-Serviceline
+43 50 124 4411
Montag–Freitag, 07:00–19:00 Uhr
Leistungen des Dachverbandes
Der Dachverband fungiert als zentrale Anlaufstelle für organisierte Selbsthilfe im Land Vorarlberg. Er bündelt Kräfte, fördert den Austausch und unterstützt Gruppen — sowohl bestehende als auch neue —beraterisch, organisatorisch und administrativ.
🛠️ Hauptleistungen & Unterstützungsangebote
Beratung für Interessierte
Wenn Sie auf der Suche nach einer passenden Selbsthilfegruppe sind :z. B. wegen Krankheit, psychischer Belastung, Sucht, Familienproblemen, etc. berät der Dachverband Selbsthilfe Vorarlberg . Sie erhalten Informationen welche Gruppen es gibt. Auch für Angehörige oder Systempartner*innen.Unterstützung bei Gruppen-Gründung
Wer eine neue Selbsthilfegruppe gründen möchte (z. B. zu einem bestimmten Thema), bekommt Unterstützung, Informationen, Begleitung und Hilfestellung. ( kostenfreie Räume, Begleitung bei den ersten Treffen, Einzelberatung und Austausch, Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit etc..)Administrative & organisatorische Begleitung
Der Dachverband hilft bestehenden Gruppen bei beraterischen, organisatorischen/administrativen Aufgaben, bei Förderanträgen und bei der Strukturierung und Begleitung der Gruppen und in der Rolle als Gruppensprecher*in.Information & Öffentlichkeitsarbeit
Betroffene, Angehörige, Fachleute erhalten Informationen über Selbsthilfegruppen, ihre Arbeit, Möglichkeiten und Grenzen. Öffentlichkeitsarbeit soll das Thema Selbsthilfe in der Gesellschaft und im Sozial-/Gesundheitsbereich sichtbarer und akzeptierter machen.Weiterbildung & Veranstaltungen
Es werden Informationsabende, Vorträge, Seminare (z. B. Kommunikation, Gruppenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit) organisiert — für Gruppenmitglieder, Interessierte und FachpersonenUnterstützung bei Förderungen
Der Dachverband begleitet und vermittelt Förderanträge (z. B. beim Vorarlberger Sozialfonds und Fachbereich Sanitätsangelegenheiten, ÖGK; FGÖ) für Gruppen bzw. Organisationen, wenn Projekte oder Objekte gefördert werden sollen.Zugang zum Gruppenverzeichnis
Es gibt ein Gruppenverzeichnis mit vielen unterschiedlichen Selbsthilfegruppen (z. B. zu psychischen Erkrankungen, Sucht, chronischen Krankheiten, Angehörigen- oder Familiengruppen etc.), wodurch Interessierte leichter passende Gruppen finden können.
Sabine Moosbrugger
Dachverband Selbsthilfe Vorarlberg
Schlachthausstraße 7c, 6850 Dornbirn
Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 16:00 Uhr
Tel.: 0043 664 43 49 654
s.moosbrugger@selbsthilfe-vorarlberg.at
